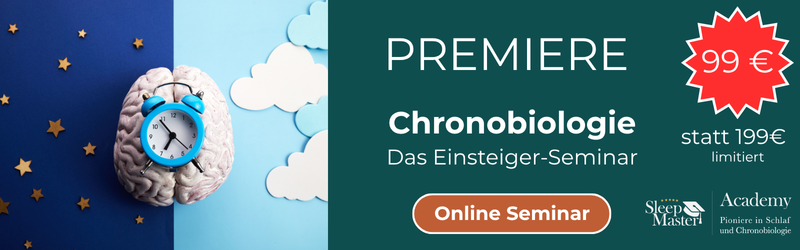ChronoGlossar – Schlaf und Chronobiologie
Fachbegriffe aus Schlaf und Chronobiologie
Derzeit befinden sich 58 Fachbegriffe in diesem Verzeichnis.
A
Adenosin
Adenosin entsteht vor allem dann, wenn die wachheitsfördernden Zentren im Hirnstamm lange aktiv sind, und dämpft dort über spezifische Rezeptoren die neuronale Aktivität. Diese Abschwächung pflanzt sich in weitere Hirnregionen fort und steigert so den Schlafdruck. Die innere Uhr beeinflusst, wann dieser Adenosin-Effekt besonders spürbar wird, auch wenn die Freisetzung selbst durch den Energieverbrauch der Neuronen bestimmt ist. Im Schlaf sinkt der Energiebedarf der Nervenzellen, sodass sich ihre Reserven wieder auffüllen und der Adenosin-Spiegel abnimmt.
Dieser Adenosin-Kreislauf schützt so das Gehirn vor auf diese Weise vor Energiemangel, der ansonsten in langen Wachphasen in besonders aktiven Hirnarealen entsteht.
Koffein unterbricht diese Rückkopplung, indem es die Adenosin-Rezeptoren blockiert und die Müdigkeit damit zeitweise kaschiert.
Aktigraphie
Aktigraphie misst Bewegungsmuster über 24 Stunden, meist mit Armbandgeräten. Sie wird zur Schlafanalyse, Rhythmusbestimmung und Erkennung von Schlafstörungen eingesetzt, besonders in Alltagssituationen.
B
Biorhythmus
Fälschlicherweise wird Chronobiologie häufig mit dem Biorhythmus verwechselt. Biorhythmus bezeichnet ein pseudowissenschaftliches Konzept, das von Wilhelm Fliess und Hermann Swoboda um 1900 entwickelt wurde. Es postuliert, dass körperliche, emotionale und geistige Zustände des Menschen in festen, regelmäßig wiederkehrenden Zyklen verlaufen, die mit dem Geburtsdatum beginnen. Diese Zyklen sollen jeweils 23, 28 und 33 Tage dauern und in Sinuskurven dargestellt werden. Die Theorie behauptet, dass an Tagen, an denen diese Kurven die Nulllinie überschreiten, besondere Hochs oder Tiefs in der Leistungsfähigkeit auftreten. Trotz seiner Popularität in den 1980er Jahren gibt es keine wissenschaftlichen Belege für diese Annahmen. Studien konnten keinen Zusammenhang zwischen den postulierten Zyklen und tatsächlicher Leistungsfähigkeit oder Stimmung nachweisen. Daher wird der Biorhythmus in der Chronobiologie nicht berücksichtigt und gilt als überholt.
Bunkerexperimente Andechs
Die Bunkerexperimente in Andechs waren chronobiologische Studien, bei denen Versuchspersonen mehrere Wochen ohne Zeitgeber wie Licht, Uhren oder soziale Signale lebten. Ziel war es zu messen, wie der menschliche circadiane Rhythmus ohne äußere Einflüsse läuft. Die Ergebnisse zeigten, dass die innere Uhr nicht exakt 24 Stunden folgt, sondern etwas länger ist und im freilaufenden Zustand langsam nach hinten driftet.
C
Chronobiologie
Die Chronobiologie ist die Wissenschaft der rhythmischen Organisation von Fauna und Flora. Sie erforscht die zeitlichen Strukturen biologischer Prozesse, insbesondere, wie innere Rhythmen Körperfunktionen wie Schlaf, Hormone und Stoffwechsel steuern. Gleichzeitig befasst sie sich mit den Auswirkungen der gesellschaftlichen Taktung auf die biologischen Rhythmen der Menschen (Human-Chronobiologie). Sie bildet die wissenschaftliche Grundlage für Chronotypen und circadiane Rhythmen.
Chronopharmakologie
Chronopharmakologie untersucht, wie die Wirkung und Verträglichkeit von Medikamenten vom circadianen Rhythmus abhängen. Die Einnahmezeit kann die Wirksamkeit und Nebenwirkungen signifikant beeinflussen.
Chronotyp
Der Chronotyp beschreibt das individuelle biologische Zeitfenster, in dem ein Mensch natürlicherweise wach, aktiv oder müde ist – also ob jemand Frühtyp (Lerche), Spättyp (Eule) oder Mediantyp (Taube) ist. Er wird genetisch bestimmt und beeinflusst Leistung, Schlafbedarf und Stimmung. Der Chronotyp hängt dabei immer auch von der Grundgesamtheit ab.
Bsp.: In Deutschland kann man ein Frühtyp sein, in China ein Normaltyp. Dies wäre der Fall, wenn z.B. Chinesen generell im Schnitt früher ohne Wecker wach werden würden. Dann wäre der frühe Typ quasi "normal" verglichen mit allen Chinesen.
ChronoWorking
Der Anglizismus ChronoWorking setzt sich aus den Begriffen "Chronobiology", also der Wissenschaft der Chronobiologie, sowie "Working" (engl. für Arbeiten) zusammen. Der Begriff beschreibt ein Arbeitsmodell, das die individuelle, biologischen Schlaf-Wach-Rhythmik (Chronotypen) der Menschen berücksichtigt, also Zeiten, in denen ein Mensch tatsächlich leistungsfähiger, konzentrierter und belastbarer ist, statt nur anwesend. Kernidee: Aufgaben und Arbeitszeiten werden so gelegt, dass sie mit dem persönlichen Chronotyp übereinstimmen. Das soll Fokus, Output und Stabilität erhöhen, verhindert aber keine Fehlorganisation, es macht sie nur sichtbarer.
Circadiane Phase
Die circadiane Phase bezeichnet den Zeitpunkt eines bestimmten circadianen Ereignisses, z. B. Temperaturminimum oder Melatoninausschüttung. Sie ist entscheidend für Schlaf- Wach-Timing und Leistungsfähigkeit.
Circadiane Rhythmen (Circadian rhythm)
Circadiane Rhythmen sind etwa 24-stündige biologische Zyklen, die Schlaf, Temperatur, Hormonproduktion und Verhalten steuern. Sie werden hauptsächlich durch Sonnenlicht im Tagesgang synchronisiert, aber vom suprachiasmatischen Nukleus (SCN) im Gehirn zentral gesteuert. Neben der Circadianen Rhythmik gibt es noch die Ultradiane (Periodendauer kürzer als 24 Stunden - z.B. Herzschlag) sowie die Infradiane Rhythmik (Periodendauer länger als 24 Stunden - z.B. Jahreszeiten).
CoFam
CoFam ist die Kurzform von "Chronotypoptimiertes Familienmanagement". Ausgangspunkt ist, dass in Lebensgemeinschaften oft unterschiedliche Chronotypen unter einem Dach leben. Dies kann zu Konflikten oder Benachteiligungen vor allem von Spättypen führen. Ziel von CoFam ist, genau diese Benachteiligung bestmöglich zu reduzieren. Dabei wird auf Erfahrungen aus COPEP, (Chronotypoptimierte Personaleinsatz- und Schichtplanung) zurückgegriffen, und an den Einsatz für Lebensgemeinschaften angepasst. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Elemente aus der Projektplanung.
COPEP
COPEP (Chronotypoptimierte Personaleinsatz- und Schichtplanung) wurde von Michael Wieden entwickelt, und erstmals bei der Klinik Wartenberg im Laufe der Projekte COPEP und ChronoClinic angewendet. Im Kern dieses Ansatzes liegt die bestmögliche Berücksichtigung des Chronotyps der Mitarbeiter:innen im Rahmen der Schicht- und Personaleinsatzplanung.
D
DLMO (Dim Light Melatonin Onset)
DLMO bezeichnet den Zeitpunkt, an dem die Melatoninkonzentration unter schwachem Licht erstmals einen definierten Schwellenwert (je nach Messmethode 3 pg/ mL (im Speichel) oder 10 pg/mL (im Blut) überschreitet. Er markiert den biologischen Beginn der Schlafbereitschaft und wird zur Bestimmung des circadianen Rhythmus und Chronotyps genutzt.
E
Entrainment
Entrainment beschreibt den Prozess, durch den sich die innere Uhr an äußere Rhythmen angleicht. Der wichtigste Taktgeber ist dabei das natürliche Licht–Dunkel-Muster. Wenn diese Signale regelmäßig auftreten, synchronisiert sich der Körper automatisch damit und hält einen stabilen Tages- und Nachtrhythmus.
Auch andere Faktoren können diese Anpassung unterstützen, etwa Temperaturverläufe, Essenszeiten oder soziale Abläufe. Entrainment sorgt letztlich dafür, dass unsere biologische Zeit mit der realen Umweltzeit im Gleichschritt bleibt.
F
Freilaufender Rhythmus (Free-Running Rhythm)
Ein freilaufender Rhythmus beschreibt den Zustand, in dem der circadiane Rhythmus ohne äußere Zeitgeber läuft. Ohne Licht-Dunkel-Signale, feste Mahlzeiten oder soziale Strukturen zeigt der Körper seine innere, biologische Tageslänge – meist etwas länger als 24 Stunden.
In den Andechser Bunkerexperimenten hat man festgestellt, dass in diesem Modus der Schlaf-Wach-Rhythmus langsam nach hinten driftet (also in Richtung 25h-Tag), weil nur die innere Uhr bestimmt, wann Schlafdruck entsteht und wann Aktivitätsphasen beginnen. Der freilaufende Rhythmus macht sichtbar, wie der Körper tickt, wenn ihn die Umwelt nicht korrigiert.
Frühtyp & Lerche
Diese beiden Bezeichnungen beschreiben einen Chronotyp. Als Frühtypen/Lerchen werden Menschen bezeichnet, deren zeitliche Lage ihres biologischen Schlaffensters im Vergleich zu allen Menschen einer Grundgesamtheit (z.B. eines Landes) früher liegt als bei der Mehrheit der Grundgesamtheit. Fälschlicherweise werden sie auch als "Frühaufsteher" bezeichnet, was jedoch lediglich die Personengruppe beschreibt, die früh am Tag aufstehen. Das können auch Spättypen sein, die mit dem Wecker früh geweckt werden.
H
Hypersomnien
Hypersomnie bezeichnet ein übermäßiges Schlafbedürfnis oder starke Tagesschläfrigkeit trotz ausreichendem Nachtschlaf. Ursachen reichen von Schlafapnoe über Depressionen bis zu neurologischen Störungen.
Hypnogramm
Ein Hypnogramm ist eine grafische Darstellung der Schlafstadien über die Nacht. Es visualisiert Non-REM- und REM-Phasen sowie deren Dauer und Abfolge.
I
Infradianer Rhythmus
Infradiane Rhythmen dauern länger als 24 Stunden, etwa Menstruationszyklus oder Jahresrhythmen. Sie zeigen, dass der Körper neben täglichen auch wöchentliche und saisonale Taktungen besitzt.
Insomnie
Insomnie ist die häufigste Schlafstörung und bezeichnet Ein- oder Durchschlafprobleme über längere Zeit. Betroffene fühlen sich trotz ausreichender Gelegenheit zum Schlafen nicht erholt. Häufig sind Stress oder unregelmäßige Schlafgewohnheiten beteiligt.
J
Jetlag
Jetlag entsteht bei Zeitzonenwechsel, wenn der circadiane Rhythmus nicht sofort angepasst wird. Typische Symptome: Müdigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme. Die Anpassung erfolgt durch Licht, Schlaf- und Essenszeiten.
L
Lichttherapie
Lichttherapie nutzt gezielt helles Licht, um circadiane Rhythmen zu synchronisieren, Schlafstörungen zu behandeln oder saisonale Depressionen zu lindern. Timing, Intensität und Dauer bestimmen den Effekt.
Lokaler Schlaf
Lokaler Schlaf bedeutet, dass das Gehirn nicht immer als Ganzes schläft oder wach ist. Einzelne Bereiche können in einen schlaf ähnlichen Zustand fallen, während der Rest weiterhin aktiv bleibt. Das passiert vor allem dann, wenn wir über unsere Grenzen gehen und der Schlafdruck hoch ist.
Typisches Beispiel: frühe Morgenstunden beim Autofahren. Die Augen sind zwar offen und die Hände am Steuer, aber im Hintergrund schalten einzelne Hirnregionen kurz ab. Es fühlt sich nach einem kleinen Konzentrationsknick an, ist biologisch aber eher ein lokaler Microsleep.
Lokaler Schlaf zeigt, wie der Organismus versucht, minimale Reparaturprozesse durchzuführen, selbst wenn wir ihn künstlich wachhalten.
M
MCTQ
Der MCTQ (Munich Chronotype Questionaire) ist ein Fragebogen, der deinen tatsächlichen Schlaf-Wach-Rhythmus im Alltag erfasst. Er wurde von Prof. Till Roenneberg und Prof. Martha Merrow 2002 an der LMU München entwickelt. Er fragt u. a. nach Einschlafzeiten, Aufstehzeiten und Unterschieden zwischen Arbeits- und freien Tagen. Daraus wird, basierend auf dem „MSFsc“, der die Mitte deines Schlafs an freien Tagen um sozialen Druck korrigiert, dein Chronotyp berechnet. Der MCTQ wird auch heute noch in zahlreichen Studien verwendet, um den Chronotyp festzulegen.
Melatonin
Melatonin ist ein circadian reguliertes Hormon, das vor allem vom SCN gesteuert wird. Es signalisiert dem Körper den Schlafbedarf, unabhängig von der direkten Lichtverfügbarkeit. Die Produktion kann bei unterschiedlichen Chronotypen auch bei Helligkeit stattfinden, weshalb die Bezeichnung „Dunkelhormon“ nur eingeschränkt korrekt ist. Helles und/oder sogenannten blaues Licht kann jedoch die Produktion unterdrücken.
MEQ
MEQ (Morningness-Eveningness Questionnaire), ist ein wissenschaftlicher Fragebogen zur Selbsteinschätzung, der klären soll, ob deine innere Uhr eher auf Morgenstunden, Abendstunden oder etwas dazwischen ausgerichtet ist. Entwickelt wurde er in den 1970ern von Horne und Östberg. Im Kern fragt der MEQ, wann du dich am wachsten fühlst und welche Tageszeiten dir natürlicherweise liegen. Die Auswertung ordnet dich dann einem Typ zu – vom ausgeprägten Morgentyp bis zum späten Abendtyp.
Interessant ist dabei, dass die selbst empfundene Leistungsspitze meist mit dem Zeitpunkt übereinstimmt, an dem die Körpertemperatur ihren Höhepunkt erreicht. Der MEQ wird bis heute häufig in Forschung und Praxis eingesetzt.
Die deutsche Version wird als "D-MEQ" bezeichnet.
Mikroschlaf
Mikroschlaf sind unbewusste, wenige Sekunden dauernde Schlafepisoden während Wachphasen, oft durch Schlafmangel ausgelöst. Sie führen zu verminderter Aufmerksamkeit und erhöhen Unfallrisiken, z.B. beim Autofahren.
MSFsc
Der MSFsc ist die „korrigierte Mitte des Schlafs an freien Tagen“. Er zeigt, wann deine innere Uhr eigentlich will, dass du schläfst, ohne Arbeitsdruck und Wecker. Weil viele an freien Tagen Schlaf nachholen, wäre die rohe Schlafmitte (MSF) verzerrt. Deshalb wird der Wert um die „Schlafschuld“ der Arbeitstage bereinigt.
Ergebnis: ein Zeitpunkt, der ziemlich ungefiltert zeigt, wo dein biologischer Takt liegt. Wenn der MSFsc deutlich später ist als deine gesellschaftlich erzwungene Schlafmitte, siehst du schwarz auf weiß, wie weit du gegen deine innere Zeit arbeitest.
N
Non-REM-Schlaf (NREM)
Der Non-REM-Schlaf umfasst in der Schlafarchitektur die leichten und tiefen Schlafstadien. Er dient vor allem der körperlichen Regeneration, Immunstärkung und Hormonregulation. Im Tiefschlaf werden Wachstumshormone ausgeschüttet und Zellreparaturen aktiviert.
Normaltyp, Mediantyp & Taube
Diese Bezeichnungen beschreiben einen Chronotyp. Als Normaltyp, Mediantyp oder Taube werden Menschen bezeichnet, deren zeitliche Lage ihres biologischen Schlaffensters im Vergleich zu allen Menschen einer Grundgesamtheit (z.B. eines Landes) im Mittel liegt. Die Bezeichnung "Normaltyp" sollte vermieden werden, da damit fälschlicherweise diese Gruppe als "Normal" angesehen, und Früh- bzw. Spättypen als anomal verstanden werden könnten.
O
Orthosomnie
Orthosomnie bezeichnet den übertriebenen Drang, perfekten Schlaf zu erreichen, meist ausgelöst durch Schlaf-Tracker, Apps und Wearables. Menschen versuchen dann zwanghaft, ihre Schlafwerte zu optimieren … und genau das verschlechtert den Schlaf. Orthosomnie ist also eine „Schlafstörung durch Selbstoptimierung“.
P
Parasomnien
Parasomnien sind ungewöhnliche Verhaltensweisen im Schlaf, etwa Schlafwandeln, Sprechen oder Albträume. Sie treten meist in bestimmten Schlafphasen auf und können durch Stress, Medikamente oder genetische Faktoren begünstigt werden.
Periphäre Uhr
Eine periphere Uhr (engl. peripheral clock) ist im chronobiologischen Kontext die zelluläre Zeiteinheit außerhalb des zentralen Taktgebers im Gehirn – also außerhalb des suprachiasmatischen Nucleus (SCN) im Hypothalamus.
Konkret:
Jede Zelle im Körper besitzt einen eigenen molekularen „Taktmechanismus“, der auf denselben Uhrengenen basiert wie im SCN (z. B. CLOCK, BMAL1, PER, CRY). Diese Gene steuern über Rückkopplungsschleifen biochemische Prozesse, sodass die Zelle einem etwa 24-Stunden-Rhythmus folgt – also weiß, wann Tag oder Nacht ist, ohne ständig Signale aus dem Gehirn zu bekommen.
Polyphasischer Schlaf
Polyphasischer Schlaf teilt die Schlafzeit in mehrere kürzere Episoden über 24 Stunden auf. Er kann theoretisch die Wachzeiten verlängern, birgt aber Risiken für Schlafqualität und circadiane Stabilität. Die Wissenschaft ist hier geteilter Meinung. Prominentester Vertreter ist hier der Fußballer Christian Ronaldo.
R
REM-Schlaf
REM-Schlaf (Rapid Eye Movement) ist die Schlafphase, in der die meisten Träume auftreten. Sie ist wichtig für Gedächtnisbildung, Emotionen und Kreativität. Das Gehirn ist dabei aktiv, der Körper weitgehend gelähmt. Wir durchlaufen während der Nacht mehrere REM-Schlaf-Phasen, die im Laufe der länger werden. Sie stehen am Ende eines jeden Schlafzyklus im Rahmen der Schlafarchitektur. Der REM-Schlaf sorgt vor allem für die Konsolidierung des prozeduralen Gedächtnis (Fertigkeiten, Motorik) und der emotionalen Verarbeitung, und ist auch wichtig für Kreativität und die Fähigkeit zur Problemlösung.
S
Schlafapnoe
Schlafapnoe ist eine schlafbezogene Atmungsstörung, bei der es zu wiederholten Atemaussetzern kommt. Diese führen zu Sauerstoffmangel, Aufwachreaktionen und Tagesmüdigkeit. Unbehandelt erhöht sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Schlafarchitektur
Die Schlafarchitektur beschreibt den Aufbau des Schlafs in wiederkehrende Zyklen aus verschiedenen Schlafstadien. Neben dem Wachzustand (W) unterscheidet man zwischen Non-REM-Schlaf (N) und REM-Schlaf (R). Der Non-REM-Schlaf teilt sich auf in:
- Einschlafphase (N1)
- stabiler Schlaf (N2)
- Tiefschlaf (N3/Slow-Wave-Schlaf)
Eine stabile Schlafarchitektur ist entscheidend für Erholung und kognitive Leistungsfähigkeit.
Schlafassoziation
Schlafassoziationen sind Bedingungen, an die sich Menschen – und besonders Babys – beim Einschlafen gewöhnen, etwa Stillen, Schaukeln, Geräusche oder bestimmte Gegenstände. Fehlen diese gewohnten Reize, fällt das Ein- oder Wiedereinschlafen meist schwerer. Babys übernehmen genau die Einschlafbedingungen, die sie vor dem Zubettgehen erleben, und erwarten sie auch nachts oder beim Nickerchen. „Negative“ Schlafassoziationen entstehen, wenn ein Kind zwingend die Unterstützung einer Bezugsperson braucht, um einschlafen zu können. Kann sich ein Baby hingegen selbst beruhigen, entwickeln sich sogenannte „positive“ Schlafassoziationen, die unabhängiger funktionieren.
Schlafassoziierte Bewegungsstörungen
Hierzu gehören Störungen wie das Restless-Legs-Syndrom (RLS) oder periodische Gliedmaßenbewegungen. Sie beeinträchtigen Einschlafen, Schlafkontinuität und Schlafqualität.
Schlafbedarf
Der Schlafbedarf beschreibt die individuell notwendige Schlafmenge, die sich aus dem Zusammenspiel zweier biologischer Prozesse ergibt: Prozess S (Schlafdruck) und Prozess C (circadiane Steuerung). Er bestimmt, wann und wie lange ein Mensch schlafen muss, um sich vollständig zu erholen.
Schlafdauer
Die Schlafdauer beschreibt die gesamte Schlafzeit innerhalb von 24h, inkl. Powernaps. Sie variiert individuell, liegt im Durchschnitt bei Erwachsenen zwischen 7 und 9 Stunden. Zu wenig oder zu viel Schlaf beeinträchtigt langfristig Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Schlafdruck (Prozess S)
Schlafdruck beschreibt den inneren Drang zu schlafen, der während der Wachzeit stetig zunimmt. Je länger wir wach sind, desto stärker baut sich dieser Druck auf. Faktoren wie vorheriger Schlafmangel, körperliche oder mentale Belastung oder Krankheit können dazu führen, dass der Schlafdruck schneller ansteigt. Schlaf reduziert diesen Druck wieder. Prozess S erklärt damit, warum wir nach langem Wachsein müde werden – unabhängig von der Uhrzeit.
Schlaffragmentierung
Schlaffragmentierung bezeichnet häufige Unterbrechungen des Schlafs, die dessen Kontinuität und Erholungsqualität mindern. Ursachen können Schlafapnoe, Lärm oder andere Störungen sein.
Schlafhygiene
Schlafhygiene umfasst Gewohnheiten und Umgebungsbedingungen, die guten Schlaf fördern, etwa feste Schlafzeiten, Dunkelheit, kein Koffein am Abend und Bildschirmverzicht. Sie ist Grundlage jeder Schlaftherapie.
Schlafinsuffizienz / Schlafdefizit
Schlafinsuffizienz bezeichnet anhaltend zu wenig oder qualitativ schlechten Schlaf. Das führt zu Leistungsabfall, Reizbarkeit und langfristig erhöhtem Krankheitsrisiko. Regelmäßiger, erholsamer Schlaf ist entscheidend für Regeneration.
Schlafkonsolidierung
Schlafkonsolidierung beschreibt die Stabilisierung von Gedächtnisinhalten während des Schlafs. REM- und Tiefschlafphasen spielen eine zentrale Rolle bei Lernprozessen und emotionaler Verarbeitung.
Schlaflatenz
Die Schlaflatenz ist die Zeitspanne zwischen dem Zubettgehen und dem tatsächlichen Einschlafen. Eine normale Schlaflatenz liegt zwischen 10 und 20 Minuten. Verkürzte oder verlängerte Latenzen können auf Stress oder (Ein-)Schlafstörungen hinweisen.
Schlafqualität
Die Schlafqualität beschreibt, wie erholsam und durchgängig der Schlaf ist. Sie hängt von der Dauer, den Schlafphasen, der Umgebung und inneren Faktoren wie Stress ab. Hohe Schlafqualität bedeutet: wenige Unterbrechungen, erholtes Aufwachen, stabile Schlafzyklen und vor allem, das Empfinden eines Erholt seins nach dem Aufwachen.
Wissenschaftlich gemessen wir die Schlafqualität u.a. über Fragebögen, wie z.B.
- Pittsburgh Schlafqualitätsindex (PSQI)
- Schlaffragebögen SF-A und SF-B
- Visuelle Analogskalen VIS-A und VIS-M
„Pittsburgh Schlafqualitätsindex (PSQI)“
„Schlaffragebögen SF-A und SF-B“
„Visuelle Analogskalen VIS-A und VIS-M“
Schlafregulation (Prozess S & Prozess C)
Die Schlafregulation beruht auf zwei Prozessen: Prozess S (Schlafdruck) steigt mit Wachzeit, Prozess C (circadiane Steuerung) regelt den optimalen Schlafzeitpunkt. Ihr Zusammenspiel bestimmt, wann wir müde oder wach sind. C+D = Schlafbedarf
Schlafstörungen
Schlafstörungen sind anhaltende Probleme beim Ein- oder Durchschlafen, zu frühes Erwachen oder nicht erholsamer Schlaf. Sie können psychische, körperliche oder umweltbedingte Ursachen haben und beeinflussen Konzentration, Stimmung und Gesundheit. Werden sie nicht behandelt, können sie sich zu chronischen Schlafstörungen ausweiten.
Schlafzyklus
Ein Schlafzyklus besteht aus aufeinanderfolgenden Non-REM- und REM-Phasen und dauert je nach individueller Prägung zwischen 70 und 110 Minuten, im Schnitt 90 Minuten. In der Regel durchlaufen wir in einer Nacht, je nach Länge des eigenen Schlafzyklus, zwischen 4 und 6 Schlafzyklen.
Sleep Tracking
Sleep Tracking erfasst Schlafdaten über EEG, Wearables oder Apps. Ziel ist Analyse von Schlafdauer, Qualität, Zyklen und circadianer Rhythmik, um Schlafprobleme zu erkennen oder zu optimieren.
Slow Wave Sleep
Auch Tiefschlaf oder Kernschlaf genannt, ist dies die erholsamste Non-REM-Phase, gekennzeichnet durch langsame Gehirnwellen (Delta). Er fördert körperliche Regeneration, Hormonproduktion und Immunsystem und ist entscheidend für Konsolidierung des deklarativen Gedächtnisses (Fakten, Wissen, Ereignisse). Er unterstützt vor allem die körperliche Regeneration und Hormonproduktion.
Sozialer Jetlag
Sozialer Jetlag entsteht, wenn der biologische Schlafrhythmus nicht mit sozialen Verpflichtungen wie Arbeit oder Schule übereinstimmt. Das ständige Leben „gegen die innere Uhr“ kann langfristig Stoffwechsel- und Stimmungsschwankungen fördern.
Spättyp & Eule
Diese beiden Bezeichnungen beschreiben einen Chronotyp. Als Spättyp/Eule werden Menschen bezeichnet, deren zeitliche Lage ihres biologischen Schlaffensters im Vergleich zu allen Menschen einer Grundgesamtheit (z.B. eines Landes) später liegt als bei der Mehrheit der Grundgesamtheit. Fälschlicherweise werden sie auch als "Langschläfer" bezeichnet, was jedoch lediglich die Personengruppe beschreibt, in Bezug auf die Schlafdauer lange schläft. Dazu können auch Frühtypen gehören.
Suprachiasmatischer Nukleus (SCN)
Der SCN ist das Steuerzentrum der inneren Uhr im Hypothalamus. Er empfängt Lichtsignale über die Augen und synchronisiert den circadianen Rhythmus, insbesondere Schlaf und Hormonproduktion. In der Wissenschaft wird er auch vereinfacht als Masterclock bezeichnet.
U
Ultradianer Rhythmus
Ultradiane Rhythmen sind biologische Zyklen, die kürzer als 24 Stunden dauern, z. B. Schlafzyklen oder Konzentrationsphasen. Sie beeinflussen Energie, Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit im Tagesverlauf.
Z